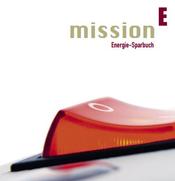Vom Militärstützpunkt zum Leben mit der Natur
Städte sind seit jeher einer der sichtbarsten Eingriffe des Menschen in die Natur. Die bebaute Landschaft wird radikal verändert, eine Vielzahl unterschiedlicher Baustoffe ist notwendig, und anschließend muss das Bauwerk mit Energie versorgt und beheizt werden. Dank moderner Technik ist es jedoch inzwischen möglich, neue Gebäude so zu errichten, dass sie sich in den natürlichen Stoffkreislauf einfügen und mit Rücksicht auf endliche Energieressourcen betrieben werden.
Kilbourne Kaserne: Leben in der Natur – mit der Natur
Die „Kilbourne Kaserne“ ist in eine gut erhaltene Naturlandschaft eingebettet – sie grenzen unmittelbar an das Schutzgebiet Dossenwald und sind landschaftlich von den Badischen Binnendünen geprägt. Schon die Wahl dieser Konversionsfläche für die Entwicklung einer neuen Wohnsiedlung ist umweltschonend, denn der dort vorhandene und nicht mehr zeitgemäße Gebäudebestand wird vollständig ersetzt.
Dieses Projekt der Stadt Schwetzingen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) soll auch im Bereich der Energieeffizienz wegweisend für die gesamte Region sein. Grundsätzlich kann ein geringer Verbrauch beim Betrieb von Gebäuden durch die energetisch optimierte Architektur und Bauphysik, leistungsfähige Wärmedämmung, den Einsatz effizienter Lüftungssysteme und die Nutzung von natürlich vorhandenen Energiequellen – allen voran die Sonne – sichergestellt werden.
Weitere Maßnahmen wie Verwendung regionaler, energiearmer und langlebiger Baustoffe oder eine Dachbegrünung, können die Umweltverträglichkeit von Bauwerken weiter steigern. Die Anforderungen an ökologisches Bauen sind in Deutschland in der Energieeinsparverordnung (EnEV) geregelt. Dennoch gibt es unterschiedliche Ansätze, wie die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden – vom Niedrigenergiehaus über das Passiv- und Nullenergiehaus bis hin zum Plusenergiehaus. Ob und welcher dieser Ansätze bei der Konversion der „Kilbourne Kaserne“ zum Tragen kommt, wird partnerschaftlich und unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten sowie den Wünschen der Bevölkerung entschieden.

Bei Passivhäusern kommen spezielle Formen und Techniken zum Einsatz (Foto: Mark Hogan, CC BY-SA 2.0)
Niedrigenergiehaus und Passivhaus
Die Anforderungen an Niedrigenergiehäuser sind in Deutschland im Energieeinsparungsgesetz (EnEG) geregelt. Dafür wird der Energieverbrauch von Gebäuden anhand eines Referenzhauses gemessen. Neubauten mit noch geringerem Verbrauch werden durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziell gefördert. Die Attraktivität der Förderung hängt von der Energieeffizienz ab. Ein KfW-Effizienzhaus 70 benötigt beispielsweise 30 Prozent weniger Energie als es die Anforderungen des EnEG vorsehen. Die verschiedenen Standards der KfW für Energieeffizienz sind:
- Neubau: 40, 55, 70
- Sanierung: 55, 70, 85, 100, 115, KfW-Effizienzhaus Denkmal
Bei Niedrigenergiehäusern kommen häufig dieselben Technologien ganz oder teilweise zum Einsatz wie bei einem Passivhaus. Beim Ansatz des Passivhauses wird dank einer guten Wärmedämmung auf die herkömmliche Gebäudeheizung verzichtet. Von den Bewohnern und deren Elektrogeräten abgegebene Wärme reicht dabei in der Regel aus, um das Haus auch im Winter zu beheizen. Frischluft wird durch einen Erdwärmetauscher vorgeheizt und von einer ausgeklügelten Belüftungsanlage im ganzen Gebäude verteilt.
Der Wärmeverlust ist bei Passivhäusern minimal, was durch die spezielle Gebäudeform, eine hinterlüftete Fassade, dreifach verglaste und mit dem Edelgas Argon gefüllte Fenster sowie diverse Wärmetauscher erzielt wird. Das Wohngefühl ist in solchen Häusern optimal, denn die Innentemperatur bleibt konstant, und die Luftqualität ist oft besser als die der Außenluft.

Das eigene Haus als Kraftwerk – Plusenergiehäuser produzieren mehr Strom, als sie verbrauchen (Foto: jingdianjiaju2, CC BY-SA 2.0)
Nullenergiehaus und Plusenergiehaus
Nullenergiehäuser produzieren im Jahresdurchschnitt mindestens so viel Energie, wie sie verbrauchen. Dabei kommen dieselben Techniken zum Einsatz, wie bei einem Passivhaus. Zusätzlich werden Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung auf dem Dach verbaut. Somit wird das Gebäude zum Produzenten von Solarstrom und ist unabhängig von Energielieferungen.
Wenn mehr Strom produziert wird, als das Gebäude verbraucht, handelt es sich um ein Plusenergiehaus. Der Energieüberschuss wird in das Stromnetz eingespeist, oder steht für die „Betankung“ von Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Ein Beispiel dieser zukunftsweisenden Technologie ist das Effizienzhaus Plus in Berlin, das vom Bundesverkehrsministerium als Versuchsanlage nach den neuesten technischen Möglichkeiten erbaut wurde. Obwohl dieses Haus als Referenz für den gleichnamigen Standard der Bundesregierung gilt, sind viele der dort eingesetzten Techniken fehleranfällig und noch nicht für den normalen Wohnungsbau geeignet.
Als innovativer Immobiliendienstleister des Bundes hat die BImA viel Erfahrung mit der energetischen Sanierung von Gebäuden und dem Neubau nach den neuesten Energiestandards. Die Konversion der „Kilbourne Kaserne“ in Schwetzingen bietet die Chance, neue Technologie für mehr Energieeffizienz und die Bedürfnisse der Schwetzinger Bevölkerung in Einklang zu bringen.
Weiterführende Informationen
- BINE Informationsdienst: Energieeffiziente Einfamilienhäuser mit Komfort
- BINE Informationsdienst: Energiesparen zu Hause
- Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Effizienzhaus Plus
- Forschung für Energieoptimiertes Bauen (EnOB)
- Gesetze im Internet: Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Energieeffizient Bauen
- Passivhaus Institut (PHI) in Darmstadt